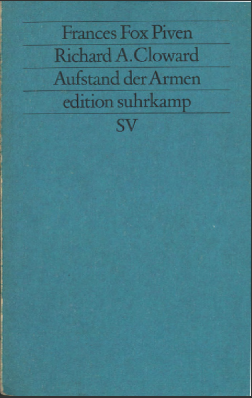 Warum erreichen soziale Bewegungen ihre Ziele manchmal und warum manchmal nicht? Wann erreichen sie mit welchen Mitteln welche Ziele? Wie können soziale Bewegungen im Kapitalismus über Anpassungen und Regulation hinaus ernsthafte systemische Veränderungen bewirken? Und inwiefern lassen sich auf der Basis bewegungsgeschichtlicher Beispiele systematische Aussagen zu diesen und weiteren Fragen treffen? Darum geht es in dem 1977 in den USA und erst 1986 in deutscher Sprache erschienenen Buch der beiden Soziologen Richard Cloward und Frances Fox Piven „Aufstand der Armen“ (engl.: Poor People’s Movements).
Warum erreichen soziale Bewegungen ihre Ziele manchmal und warum manchmal nicht? Wann erreichen sie mit welchen Mitteln welche Ziele? Wie können soziale Bewegungen im Kapitalismus über Anpassungen und Regulation hinaus ernsthafte systemische Veränderungen bewirken? Und inwiefern lassen sich auf der Basis bewegungsgeschichtlicher Beispiele systematische Aussagen zu diesen und weiteren Fragen treffen? Darum geht es in dem 1977 in den USA und erst 1986 in deutscher Sprache erschienenen Buch der beiden Soziologen Richard Cloward und Frances Fox Piven „Aufstand der Armen“ (engl.: Poor People’s Movements).
Das Buch erschien damals bei Suhrkamp mit einem ausführlichen Vorwort von Stephan Leibfried und Wolf-Dieter Narr mit dem Titel „Sozialer Protest und politische Form. Ein Plädoyer für Unruhe, Unordnung und Protest“. Es ist derzeit so vergriffen, dass es nicht einmal in den Internet-Antiquariaten erhältlich ist. Und Suhrkamp hat offensichtlich anderes zu tun als Bewegungs-Empowerment-Literatur neu aufzulegen. Daher gibt’s das Buch jetzt hier bis auf weiteres als Volltext zum Download.
Wer erstmal eine interessante Buchbesprechung lesen will, der oder die sei auf die Besprechung von Christian Frings im Labournet verwiesen, die beinahe Einführungscharakter hat.
Im der Monatzeitung „analyse&kritik“ konnte man vor einiger Zeit nachlesen, wie das scheinbar alte Buch sehr anregend sein kann auch für ganz aktuelle bewegungsstrategische Debattenbeiträge. Olaf Bernau von NoLager Bremen empfiehlt im ak Nr. 541 vom 21.8.2009 „Runter vom Beobachtungsturm“ und bedient sich zur Untermauerung seiner Thesen sehr ausführlich bei Piven und Cloward. Er kommt zu dem Ergebnis, so der Untertitel: „Die bewegungsorientierte Linke ist auf etwaige Krisenproteste unverändert schlecht vorbereitet“.
Hier auch der volle Text dieses ak-Artikels, der dort auf der Homepage leider nicht online ist:
Geht es um praktische Kriseninterventionen, ist ein gewisser Hang zum Abstinenzlerischen unübersehbar: Im Zentrum der Debatte stehen gemeinhin programmatische und bündnistaktische Erwägungen. Demgegenüber spielt die Frage, unter welchen Bedingungen es überhaupt zu Widerständigkeiten bzw. sozialen Kämpfen kommt, eine eher marginale Rolle. Es ist also kaum verwunderlich, dass die allenthalben artikulierte Forderung nach lokalen Krisenbündnissen immer wieder im bloßen Appell stecken bleibt: Nicht zuletzt die konkrete Bestimmung, wie sich soziale Bewegungen in betriebliche und andere Auseinandersetzungen einbringen könnten, wird häufig nur am Rande gestreift.
Exemplarisch lässt sich dies anhand dreier Debattenbeiträge aus der
jüngeren Zeit verdeutlichen: Unter dem Titel „Agenda 2009: Menschen
statt Profite“ haben im Anschluss an die Krisendemonstrationen am 28.
März diverse (in unterschiedlichen Organisationen und Bündnissen aktive)
Einzelpersonen sowie die Gruppe soziale Kämpfe den Versuch einer
strategischen Standortbestimmung unternommen (ak 539). Große Teile des
Papieres beschäftigen sich mit der Analyse des herrschenden
Krisenmanagements sowie der Formulierung programmatischer
Gegenperspektiven. Wie indessen die ins Auge gefasste
„Widerstandsagenda“ realisiert werden soll – inklusive politischem
Streik, ja Generalstreik – bleibt ungeklärt. Gewiss, am Ende des
Beitrages werden stichwortartig Termin- und Aktionsvorschläge
unterbreitet, dennoch fehlt eine wie auch immer vorläufige Analyse
aktueller Kräfteverhältnisse, also auch eine Auseinandersetzung mit den
Konsequenzen jener zahlreichen Niederlagen, welche nicht nur das globale
Proletariat, sondern auch soziale Bewegungen in den letzten zwei bis
drei Jahrzehnten erlitten haben. Hintergrund dieses Mankos dürfte die
mittlerweile hinreichend erschütterte Annahme sein, wonach die Finanz-
bzw. Wirtschaftskrise zugleich eine grundlegende Legitimitätskrise des
Kapitalismus hervorgebracht und somit quasi automatisch (sic) ein
Fensterchen für emanzipatorische Politiken geöffnet habe. Ganz ähnlich
verhält es sich mit dem Diskussionsbeitrag „Wie weiter nach dem 28.
März?“, den Angela Klein für die Aktionskonferenz in Kassel am 27./28.
Juni verfasst hat: Sie spricht zwar von „Ohnmacht und Angst“, welche
sich in der Bevölkerung ausbreiten würden, frönt dann allerdings einem
fast schon frivol anmutenden Krisenoptimismus: „Gleichzeitig – und das
ist kein Widerspruch – weist die Stimmungslage eine Tendenz zur
Radikalisierung auf; es geht die Rede vom Generalstreik; es gibt erste,
wenn auch kurzzeitige Betriebsbesetzungen; es gibt an verschiedenen
Orten Kämpfe, die den Willen ausdrücken, trotz Krise den eigenen
Lebensstandard zu behaupten.“ Kurzum: Auch bei Angela Klein sind keine
Antworten auf die Frage zu finden, wie soziale Kämpfe – ob mit oder ohne
linke Beteiligung – zu ihrer vormaligen Stärke zurückfinden könnten.
Denn auch sie scheint, Krise und Widerständigkeit umstandslos
kurzzuschließen – ohne systematische Analyse jener Bedingungen, die
gegeben sein müssen, damit Proteste überhaupt zustandekommen und eine
ernsthafte, in der Breite verankerte Eigendynamik entfalten können.
Schließlich Thomas Seibert: In seinem Beitrag „Die Unbestimmtheit
nutzen, dem Ereignis auflauern“ (ak 540) lässt er die von ihm vage am
Horizont erspähten sozialen Unruhen zum bloßen „Ereignis“
zusammenschnurren. Entsprechend kreisen seine Überlegungen in erster
Linie um die organisierte Linke, also jenes Spektrum zwischen
Linkspartei, linken GewerkschafterInnen, attac und radikaler Linke.
Vieles davon ist grundlegend, insbesondere die von Thomas Seibert schon
seit längerem propagierte Devise, dass Kooperation in Bündnissen die
prinzipielle Bereitschaft voraussetze, den jeweiligen
BündnispartnerInnen ihre Eigenständigkeit zu belassen. Allein: Eine
„Strategie- und Organisationsdebatte“ – wie sie Thomas Seibert
vorschlägt – lässt Entscheidendes außen vor, wenn sie den Graben
zwischen organisierter Linker und ‚durchschnittlicher‘ Bevölkerung zu
groß werden lässt und wenn sie obendrein nicht darzulegen vermag, wie
die organisierte Linke ohne (krypto-)leninistische Allüren in
betrieblichen und anderen Konflikten aktiv werden könnte.Protest und offensiver Widerstand sind keine Selbstläufer, sie können
nicht kurzerhand aus objektiven Makro-Daten wie massenhaften
Betriebsschließungen oder Reallohnverlusten abgeleitet werden. Wer so
argumentiert, projiziert eigene Gerechtigkeitsvorstellungen in den
gesellschaftlichen Raum, und das mit der Konsequenz, dass unerklärlich
wird, weshalb konflikthafte, ja militante Kampfzyklen immer wieder von
defensiven, zeitlich oft lange andauernden Phasen unterbrochen werden,
in denen soziale Kämpfe merklich zurückgehen bzw. ihren Charakter ändern
und allenfalls unter der Oberfläche – meist als individuelle
Überlebensstrategien – weiterbrodeln. Vor diesem Hintergrund liegt es
nahe, zunächst einmal der Frage nachzugehen, unter welchen
Voraussetzungen es in Schwellen- und Industrieländern seitens der
subalternen – politisch nicht weitergehend organisierten – Klassen
überhaupt zu offensiven Widerständigkeiten kommt. Das ist einerseits
schwierig, da jeder Streik oder Konflikt eine hochgradig individuelle
Angelegenheit darstellt – insofern ist die etwaige Reichweite bzw.
Plausibilität der hier zusammengetragenen ‚Faktoren‘ von Fall zu Fall
neu zu bewerten. Andererseits blickt die gesellschaftliche Linke im Feld
sozialer (Klassen-)Kämpfe auf eine derart lange und durchaus
erfolgreiche Geschichte zurück, dass es geradezu sträflich wäre, die
darin schlummernden Einsichten nicht für aktuelle Kämpfe fruchtbar zu
machen. (1)a) Existentieller Druck & kollabierende Routinen: In ihrem Klassiker „Aufstand der Armen“ (original: 1977) entwerfen die US-TheoretikerInnen Frances Piven und Richard Cloward eine Art Drehbuch sozialer Kämpfe – expliziert anhand der US-amerikanischen Arbeitslosen- und ArbeiterInnenbewegungen in den 1930er Jahren sowie der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und der ebenfalls überwiegend schwarzen Bewegung der WohlfahrtsempfängerInnen seit den 1950er Jahren. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist ein zweifacher: Einerseits stünde am Anfang jeder größeren Protestwelle existentieller Druck, beispielsweise durch plötzliche Not oder enttäuschte Erwartungen. Andererseits bedürfe es des Zusammenbruchs der regulativen Kräfte einer Gesellschaft – quasi als Voraussetzung dafür, dass die Betroffenen überhaupt auf die Barrikaden gingen. Konkreter: Sozioökonomische Einbrüche fielen bisweilen derart einschneidend aus, dass die herkömmlichen Strukturen und Abläufe des Alltagslebens und somit auch die loyale Anbindung der Menschen an die herrschende Sozialordnung kollabieren würden. Tiefenschärfe gewinnt dieses Szenario freilich erst, wenn der nebulös anmutende Terminus des
„existentiellen Drucks“ konkretisiert wird. Denn die diesbezügliche
Bandbreite ist – wie bereits angedeutet – beträchtlich, auch wenn
umgekehrt nie aus dem Blick geraten sollte, dass sich die
unterschiedlichen Dimensionen oftmals ergänzen bzw. überlappen:Erstens: Historisch am relevantesten dürfte – jedenfalls bis zum Zweiten
Weltkrieg – die Erfahrung plötzlicher sozialer Deklassierung gewesen
sein. Was das konkret heißt, ist heutzutage immer dann zu erleben, wenn
mehr oder weniger unerwartet Massenentlassungen bzw.
Betriebsschließungen bekannt gegeben werden. So haben entsprechende
Entscheidungen – um nur drei Beispiele zu nennen – 2004 bei Opel in
Bochum, 2005 im AEG-Werk in Nürnberg und 2007 bei Bike-Systems in
Nordhausen jeweils spontan wilde Streiks bzw. de
facto-Betriebsbesetzungen nach sich gezogen. Noch dramatischer ist die
Situation, wenn ganze Branchen abgewickelt werden sollen: Erinnert sei
nur an den einjährigen – streckenweise bürgerkriegsartigen –
Bergarbeiterstreik 1984/85 in Großbritannien, welcher jedoch den
tatsächlich erfolgten Abbau von 580.000 Arbeitsplätzen im Bergbau nicht
aufzuhalten vermochte. Am nachhaltigsten hat sich – das ist in der
aktuellen Krisenberichterstattung einmal mehr deutlich geworden – die
Weltwirtschaftskrise in den frühen 1930er Jahren ins kollektive
Gedächtnis eingebrannt: 1933 sind zum Beispiel in den USA ein Drittel
der Erwerbsbevölkerung arbeitslos gewesen, zugleich ist das gesamte
Lohneinkommen zwischen 1929 und 1933 von 51 auf 26 Milliarden gesunken.
Umgekehrt ist dies, so Frances Piven und Richard Cloward, zwischen 1933
und 1937 mit einer für US-Verhältnisse ebenso unbekannten wie
erfolgreichen Massenmilitanz größerer Teile der ArbeiterInnen-Bewegung
einhergegangen.Zweitens: Eine völlig anders gelagerte Dynamik ist das Phänomen
enttäuschter Erwartungen – auch bekannt als ‚relative Deprivation‘:
Häufig zitiertes Beispiel sind die jungen, aus dem agrarisch geprägten
Süditalien in die norditalienischen Industriezentren migrierten
MassenarbeiterInnen, welche seit den frühen 1960er Jahren vor allem
deshalb auf den Putz gehauen haben, weil ihre ursprünglichen
Aufstiegserwartungen in nahezu jedweder Hinsicht nicht aufgegangen sind.
Ganz ähnlich in Deutschland: Allein im August 1973 legten 80.000
MetallarbeiterInnen in wilden Streiks ihre Arbeit nieder. Ihnen waren
die seitens der IG Metall ausgehandelten Lohnerhöhungen von 8,5 Prozent
schlicht zu niedrig – jedenfalls im Lichte der damaligen Teuerungsrate.
Spätestens vor diesem Hintergrund dürfte deutlich werden, dass Routinen
und Loyalitäten nicht nur in der Krise, sondern auch im Zuge offensiver
Streikzyklen kollabieren bzw. ihre Ausrichtung ändern können.Drittens, zurück nach Italien: Die Kritik der MassenarbeiterInnen
richtete sich nicht zuletzt gegen das despotische Fabrikregime – ein
Umstand, welcher sich im Laufe der 1960er Jahre bei vielen von ihnen zu
einer grundsätzlichen Kritik kapitalistischer Lohnarbeit zugespitzten
sollte. Wichtig ist jener Umstand insofern, als hohe
Bandgeschwindigkeiten, schlechter Gesundheitsschutz, verweigerte
Mitbestimmung etc schon lange wichtige Auslöser defensiver wie
offensiver Arbeitskämpfe darstellen: So streikten die ArbeiterInnen in
den USA Anfang der 1930er Jahre zunächst einmal für das Recht, überhaupt
betriebliche Vertretungsstukturen bilden und offiziell mit den
Unternehmen (Tarif-)Verhandlungen führen zu können; in den 1960er Jahren
setzten sich FordarbeiterInnen in Köln für eine stündliche Band- bzw.
Akkordpause ein; und der Besetzung der berühmten Kachelfabrik Zanon 2001
in Argentinien ist – gleichsam als erste gemeinsame Kraftprobe – ein
9-tägiger Streik für besseren Arbeits- und Gesundheitsschutz im März
2000 vorausgegangen.Viertens: Der Kampf um die eigene Würde ist ein Bewegggrund, welcher in
vielen Auseinandersetzungen eine mehr oder weniger tragende Rolle spielt
– darauf hat auch der Betriebsratschef von New-Fabris unmissverständlich
aufmerksam gemacht, jener Autozuliefererfirma in Frankreich, auf der
streikende Arbeiter mehrere Wochen lang explosive Gasflaschen deponiert
hatten: „Wir stehen vor dem Elend (…). Wir sollten uns nicht wegwerfen
lassen wir Dreck. Wir müssen gegen all diese Entlassungen in Frankreich
und in anderen europäischen Ländern kämpfen.“b) Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte: Das Moment der Würde
verweist auf einen elementaren Sachverhalt: Der Druck mag noch so groß
sein, zu Widerständigkeit und Protest kommt es erst, wenn die
diesbezüglichen Erfahrungen als ungerecht interpretiert bzw. empfunden
werden. Das aber ist keineswegs selbstverständlich, sind doch die
gesellschaftlichen Akteure – bei aller Bereitschaft zur Rebellion – den
herrschenden Verhältnissen zunächst einmal in habitueller, d.h.
kognitiver, normativer und affektiver Hinsicht mehr oder weniger
weitgehend verpflichtet. Es ist insofern kaum verwunderlich, dass dieser
ebenso simple wie grundlegende Sachverhalt linke TheoretikerInnen schon
immer beschäftigt hat – wichtige Schlagworte lauten etwa: ‚Ideologie als
notwendig falsches Bewusstsein‘ (Marx/Engels), ‚verdinglichtes
Bewusstsein‘ (Lukácz), ‚autoritärer Charakter‘ (Adorno), ’spontaner
Konsens, Alltagsverstand und kulturelle Hegemonie‘ (Gramsci), ’sense of
one’s own place‘ (Bourdieu) etc. Kurzum: Wer auf Krisenproteste setzt,
sollte nicht nur Bankenzusammenbrüche und Exportdaten in Augenschein
nehmen, sondern auch die „moralische Grammatik sozialer Konflikte“ (Axel
Honneth). Denn sämtliche Erfahrungen zeigen, dass derartige (sowohl
persönlich als auch kollektiv zu realisierende) Prozesse praktischer
Dissidenz ein schwerfälliges und langwieriges – auf jeden Fall kein
automatisches – Unterfangen sind: In den USA hat es, wie gesagt, 3 bis 5
Jahre gebraucht, bis sich die ArbeiterInnen gegen die Folgen der
Weltwirtschaftskrise massenhaft zur Wehr gesetzt haben. Genausowenig
sind in Italien und Deutschland der „heiße Herbst“ bzw. die
„Septemberstreiks“ im Jahr 1969 vom Himmel gefallen. Vorausgegangen
waren vielmehr – als eine Art Inkubationszeit – die fälschlicherweise
oft als streikarm bezeichneten 1960er Jahre: In einer Vielzahl wilder,
oftmals lokal verankerter sowie mehr oder weniger diskret durchgezogener
Streiks und Auseinandersetzungen konnten immer wieder Erfahrungen in
kollektiver Selbstorganisierung, konfrontativer Selbstbehauptung,
externer Solidarität etc. gesammelt werden – inklusive der schrittweisen
Aneignung subversiver bzw. kritischer Denk- und Wahrnehmungsmuster, auf
deren Basis dissidente Wirklichkeitsinterpretationen überhaupt erst
möglich wurden (nebst Überwindung von Angst, Scham und Konformismus).c) Organisierung & Unberechenbarkeit: Ohne organisierte Kerne, welche
die Initiative ergreifen, ist sozialer Aufruhr undenkbar. In
betrieblichen Auseinandersetzungen sind dies gemeinhin – insbesondere
bei wilden Streiks, Betriebsbesetzungen oder konspirativ eingefädelten
Warnstreiks – basisorientierte Betriebsgruppen, linke VertreterInnen des
gewerkschaftlichen Vertrauenskörpers oder parteipolitsch gebundene
Kader. Es gibt aber auch Ausnahmen: Bei Gate Gourmet haben sich bereits
2003 – also über zwei Jahre vor dem Streik – mehrere, nur zum Teil
politisch erfahrene ArbeiterInnen als konspirativ agierende
Widerstandszelle zusammengetan: Einerseits um den unternehmenshörigen
Betriebsratschef abzusägen, was tatsächlich gelungen ist, andererseits
um die einst äußerst stark mit dem Unternehmen identifizierte
Belegschaft auf die Notwendigkeit eines Streiks einzustimmen (seitdem es
im Zuge eines Besitzerwechsels zu krasser Verdichtung der
Arbeitsabläufe, völliger Flexibilisierung der Arbeitszeiten und
absichtsvoller Schikanierung, ja Entwürdigung der ArbeiterInnen gekommen
war). Es ist daher auch folgerichtig gewesen, dass jenes U-Boot den
ganzen 6-monatigen Streik über als informelle Streikleitung und somit
Gegengewicht zur Gewerkschaft fungiert hat. Und doch: Selbst wenn
sämtliche Zeichen auf Streik bzw. Aufruhr stehen – im Sinne des bislang
Dargelegten –, es gibt keinerlei Garantie, dass dies am Ende auch
tatsächlich geschieht. Oder mit Rosa Luxemburg: Es ist „äußerst schwer,
vorauszusehen und zu berechnen, welcher Anlass und welche Momente zu
Explosionen führen können und welche nicht (…). Die Revolution ist (…)
nicht ein Manöver des Proletariats im freien Felde, sondern sie ist ein
Kampf mitten im unaufhörlichen Krachen, Zerbröckeln, Verschieben aller
sozialen Fundamente.“d) Erfolgsbedingungen sozialer Kämpfe: Ob soziale Kämpfe erfolgreich
verlaufen, hängt – je nach Situation – von ganz verschiedenen Faktoren
ab. Zwei von ihnen seien erwähnt – einmal mehr unter selektivem
Rückgriff auf Frances Piven und Richard Cloward: Erstens: Historisch
waren es insbesondere militante bzw. offensive Massenaktionen, welche
den ökonomischen und politischen Eliten substantielle Zugeständnisse
abgerungen haben – jedenfalls insoweit es gelungen ist, dem eigenen
Anliegen in der Öffentlichkeit Legitimität zu verleihen und somit die
politischen Entscheidungsträger früher oder später unter massiven
Interventionsdruck zu setzen. Auf diesen Doppel-Mechanismus weist auch
Rainer Thomann in einer jüngst erschienenen Studie zu
„Betriebsbesetzungen als wirksame Waffe im gewerkschaftlichen Kampf“
hin: Hinsichtlich eines im Jahr 2008 erfolgreich verlaufenen
Arbeitskampfes in einem großen Eisenbahn-Instandsetzungswerk in
Bellinzona/Schweiz heißt es, dass es nur durch die entschlossene
Betriebsbesetzung gelungen sei, einen Ort öffentlich wirksamer
Gegenmacht zu etablieren – zuungusten der ansonsten üblichen Aufnahme
von Sozialplanverhandlungen, an deren Ende gleichsam per defintionem die
Schließung des Betriebes stünde. Bemerkenswert ist diese Erfahrung
insofern, als sie für soziale Bewegungen hierzulande ein riesiges, bis
heute nahezu brachliegendes Agitationsfeld eröffnet – einschließlich
glorreicher Ausnahmen wie z.B. die breite Unterstützung des (verlorenen)
Betriebskampfes bei AEG in Nürnberg 2005/06. Zweitens: Nicht nur
politisch, auch materiell und strategisch ist der Erfolg sozialer Kämpfe
maßgeblich davon abhängig, inwieweit externe Unterstützung mobilisiert
werden kann. Drei Beispiele: Der britische Bergarbeiterstreik ist zwar
grandios gescheitert, möglich ist der einjährige Arbeitskampf aber nur
deshalb gewesen (vor dem Hintergrund nicht existierender Streikkassen in
Großbritannien), dass insgesamt 65 Mio. Pfund in Gestalt von Sach-,
Nahrungs- und Geldspenden akquiriert werden konnten; als die besetzte
Kachelfabrik Zanon in Argentinien 2003 erstmalig geräumt werden sollte,
wurde nicht nur zum provinzweiten Generalstreik aufgerufen, vielmehr
hatten sich auch 5000 Menschen als Schutzschild vor der Fabrik
eingefunden; auch die Abwicklung von Bike-Systems in Nordhausen konnte
nicht verhindert werden, dennoch sollte nicht in Vergessenheit geraten,
dass die einwöchige Produktion von 1800 Strike-Bikes (welche sowohl für
die Beschäftigten, als auch für die undomatische Linke eine äußerst
beflügelnde Erfahrung war) einzig durch reichhaltige Unterstützung von
‚außen‘ möglich gemacht wurde.Noch im Frühjahr war allenthalben Krisenoptimismus en vogue – Slave
Cubela sprach beispielsweise von der Krise als Treibhaus, ja von
sozialen Kämpfen als zu erwartenden „Treibhausblüten“ (express 4/2009).
Dahinter stand zum einen die Erwartung, dass durch gravierende
Turbulenzen das „erstarrte soziale Wissen“ (Slave Cubela) erodieren
würde, etwa weil die Menschen durch abrupt in die Höhe schnellende
Arbeitslosenzahlen realisieren könnten, dass der Verlust des
Arbeitsplatzes mitnichten selbstverschuldet sei. Zum anderen zirkulierte
die Hoffnung, dass es durch die Globalität der Krise zu einer
teppichartigen Synchronität der Kämpfe und somit einem Überschwappen des
Aufruhrs in bis dato ruhige Gefilde käme. Und doch: Nicht nur der
bisherige Krisenverlauf, auch etliche der hier skizzierten Erfahrungen
mit sozialen Kämpfen in der Vergangenheit sprechen dafür, mit Prognosen
hinsichtlich aufkeimender ‚Krisenproteste‘ zukünftig vorsichtiger zu
hantieren – jedenfalls, was hiesige Verhältnisse anbelangt:a) Gewiss, die Überakkumulationskrise als strukturelle Ursache der
aktuellen Weltwirtschaftskrise besteht unverändert fort. Dennoch führt
kein Weg an der Einsicht vorbei, dass es den ökonomischen und
politischen Eliten in ihrem bisherigen Krisenmanagement besser als
erwartet gelungen ist, all zu intensive Ausschläge nach unten zu
vermeiden. Ob es also – im Sinne von Frances Piven und Richard Cloward –
tatsächlich zu kollabierenden Loyalitäten und Routinen (samt Kämpfen)
kommen wird, scheint derzeit keinesfalls ausgemacht. Und das auch
deshalb, weil die nach der Bundestagswahl drohende Abwälzung der
krisenbedingten Milliardenschulden auf die Allgemeinheit ihre fatalen
Effekte nicht in einem großen Showdown, sondern vielmehr scheibchenweise
– das heißt auf Jahre gestreckt – entfalten dürfte.b) Insbesondere in den Industrieländern hat die ArbeiterInnenbewegung im
Zuge der neoliberalen Globalisierung dramatische Niederlagen erlitten
(vgl. ak 535). Das hat nicht nur objektiv ihre Kampfkraft geschwächt –
exemplarisch erwähnt sei die umfassende Prekarisierung der
Arbeitsverhältnisse (samt Fragmentierung durch Leiharbeit,
Teilzeitarbeit, Minijobs etc.). Auch in subjektiver Hinsicht haben die
Niederlagen deutliche Spuren hinterlassen, nicht zuletzt durch den
Verlust konkreter Organisations-, Kampf- und Machterfahrungen. Mehr
noch: Zahlreiche Menschen sind regelrecht demoralisiert worden, etwa
davon, dass es trotz Massenprotesten nicht gelungen ist, die Einführung
von Hartz IV zu verhindern. Dieser Umstand spiegelt sich auch in einer
von Gero Neugebauer für die Friedrich-Ebert-Stiftung unter dem Titel
„Politische Milieus in Deutschland“ erstellten Studie wider: Danach sei
im „abgehängten Prekariat“ – also in jenen von der Krise (potentiell) am
stärksten betroffenen Mileus – „das Politikinteresse sowie das
politische Kommunikations- und Teilhabeverhalten unterdurchschnittlich“.
Vieles spricht demnach dafür, dass es in nächster Zeit zu einem
permanenten Auf- und Abflauen sozialer Kämpfe kommen wird und erst im
Schlepptau davon zu einer allmählichen Herausbildung substantieller,
breit verankerter Konfliktfähigkeit – vergleichbar den Erfahrungen in
den frühen1930er Jahren in den USA sowie den 1960er Jahren in
Westeuropa.c) Ebenfalls problematisch ist, dass die Gewerkschaften bis heute nicht
die notwendigen Konsequenzen aus den in der neoliberalen Globalisierung
begründeten Erpressungspotentialen gezogen haben – Stichwort:
Standortwettbewerb. Auf jeden Fall steht der Aufbau transnationaler
Gewerkschaftsstrukturen weiterhin nicht oben auf der Agenda – ein Manko,
worauf unter anderem der ver.di-Linke Werner Sauerborn unverdrossen
aufmerksam macht (vgl. etwa: express 01/2009).d) Schließlich sollte nicht unterschlagen werden, dass auch die
bewegungsorientierte Linke unverändert schwach aufgestellt ist – der von
manchen erhoffte Stabilisierungseffekt durch die Proteste in Heiligedamm
ist mit anderen Worten nicht eingetreten. Insofern sind von dieser Seite
in naher Zukunft wohl keine außergewöhnlichen Aktivitäten hinsichtlich
‚Krisenprotesten‘ bzw. Klassenkämpfen zu erwarten.Bei aller Skepsis, es wäre sachlich falsch und politisch
kontraproduktiv, nunmehr das Handtuch zu werfen – denn es gibt durchaus
Risse im Putz: Der wilde Streik bei Opel im Oktober 2004, der
hartnäckige (wenn auch nicht sonderlich erfolgreiche) Streik im
Einzelhandel (2007/08), der Lokführer-Streik (2007/08), die
Emmely-Kampagne (seit 2007) – all diese und weitere (zum Teil bereits
erwähnte) Beispiele zeigen, dass auch hierzulande Widerständigkeit
möglich ist. In diesem Sinne sei abschließend die Frage aufgeworfen,
welche Rolle die bewegungsorientierte Linke im kommenden Krisengeschehen
spielen könnte bzw. sollte:a) Zweierlei dürfte unstrittig sein: Die Krise kann jedeN treffen –
Erwerbslose, abhängig Beschäftigte, Studierende, NutzerInnen
öffentlicher Dienstleistungen etc. Das aber heißt, dass Krisenkämpfe an
ganz verschiedenen Orten ausbrechen können. Zudem gilt, dass es keinen
privilegierten Durchsetzungsmechanismus gibt, denn jede Gruppe hat ihre
ganz eigenen Vorgehensweisen, mittels derer konkreter Druck entfaltet
werden kann – sei es Streik, Besetzung, Demonstration oder eine
Kombination aus alle dem. Mit anderen Worten: Es wäre zu kurz gegriffen,
lokale Krisenbündnisse als bloße Vernetzungsorte zu bestimmen. Im
Mittelpunkt sollte vielmehr das (in sozialen Zentren, workers centers
oder ähnlichen Orten verankerte) Bemühen stehen, sich wechselseitig in
der Entfaltung unmittelbaren Drucks zu unterstützen – und das auf
mindestens fünf Weisen: Taktisch-Strategisch (Blockaden gegen
StreikbrecherInnen etc), diskursiv-medial (Solidaritätsaktionen etc.),
politisch-programmatisch (Propagierung globaler Solidarität – zuungusten
chauvinistischer bzw. rassistischer Krisenlösungsstrategien etc.),
praktisch-organisatorisch (Vernetzung mit anderen Streikollektiven etc)
sowie solidarisch-konkret (FahrerInnendienste etc.).b) Die verbindliche Beteiligung an konkreten Kämpfen (ob als BetroffeneR
oder UnterstützerIn) stellt erfahrungsgemäß eine extrem
nervenaufreibende Angelegenheit dar. Vor diesem Hintergrund nehmen sich
die zahlreichen Appelle der vergangenen Monate reichlich skurril aus,
wonach lokale Krisenbündnisse stets darauf achten sollten, Wirtschafts-,
Energie-, Klima- und Ernährungskrise gleichermaßen zu behandeln. Wer so
argumentiert, unterschätzt nicht nur die praktisch-alltäglichen
Erfordernisse in konkreten Auseinandersetzungen – nebst unvermeidbarer
‚Betriebs’blindheiten. Nein, verkannt wird auch, dass praktische Kämpfe
völlig anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegen als diskursive
Interventionen. Eine Problematik, welche ihrerseits auf den Umstand
verweist, dass sich große Teile der bewegungsorientierten Linken bis
heute nicht entschieden haben, ob sie ProtagonistInnen in sozialen
(Klassen-)Kämpfen werden möchten (ganz gleich, in welcher Position) oder
ob sie ihre Rolle vornehmlich in der Organisierung punktueller
Großevents bzw. zeitlich befristeter Kampagnen sehen.c) Gerade weil sich soziale Kämpfe als eine Art schwarzes Loch entpuppen
können (denn Taktgeber ist nicht der eigene Terminkalender, sondern die
Konfrontationsdynamik mit einem realen, hochgradig interessegeleiteten
Gegner), ist es naheliegend, auf lokaler Ebene die meist nicht
sonderlich üppigen Kräfte an lediglich zwei oder drei
Auseinandersetzungspunkten zu bündeln – unbeschadet dessen, wie
partikular bzw. nicht-repräsentativ jeder konkrete Kampf auf den ersten
Blick erscheinen mag. Denn erfahrungsgemäß kann auf diese Weise durchaus
beträchtliche Resonanz erzielt werden – mit der Konsequenz, dass die
eigene Glaubwürdigkeit und Mobilisierungskraft rasant wächst, nicht
zuletzt im Rahmen symbolisch-diskursiv ausgerichteter Großereignisse
bzw. Aktionstage a lá 28. März.
Olaf Bernau/NoLager Bremen(1) Aus Gründen der Übersichtlichkeit beziehe ich mich auf der Ebene der
Beispiele in erster Linie auf Arbeitskämpfe. Über die im Text gemachten
Literaturangaben hinaus möchte ich insbesondere auf folgende Bücher
verweisen:
Nanni Balestrini/Primo Moroni, Die goldene Horde. Arbeiterautonomie,
Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien, Schwarze Risse 1994;
Torsten Bewernitz (Hrsg), die neuen Streiks, Unrast 2008;
Peter Birke, Wilde Streiks im Wirtschaftswunder, Campus 2007;
Flying Pickets (Hrsg), Sechs Monate Streik bei Gate Gourmet, Assoziation
A 2007;
Holger Marcks/Matthias Seiffert (Hrsg), Die großen Streiks, Unrast 2008;
Radaktion Druckwächter (Hrsg), Akteure berichten über den Arbeitkampf
bei AEG/Elektrolux in Nürnberg 2005-07, Die Buchmacherei
2009;
Transact Nr 2 „Krise und soziale Kämpfe“ (http://transact.noblogs.org);
Wildcat 68, Beilage zu Fabrikbesetzungen in Argentinien, Sommer 2004.

Soziale Kämpfe lassen sich nicht verschieben! – der revolutionäre Krisenstab
http://www.bundesweite-montagsdemo.com/
https://solidaritaet.info/wp-content/uploads/2020/03/rheinhausen-678×452.jpg
http://www.msvportal.de/forum/threads/164-tage-k%C3%A4mpfen-%E2%80%93-am-ende-vergeblich.9668/
https://solidaritaet.info/wp-content/uploads/2020/09/Strajk_sierpniowy_w_Stoczni_Gdanskiej_im._Lenina_34-678×452.jpg
Zähne zeigen – angreifen – zuschlagen!
https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=http%3A%2F%2Fwww.linke-t-shirts.de%2Fimages%2Fdetails%2FDLF86884.jpg&sp=1601660383Tca01fccc48fe806307819d6731e06d4b09b64e9883380510fa1ac78f51243c9a
[…] (…) Amplify’d from http://www.who-owns-the-world.org […]
Der Text ist jedoch als pdf-Datei bei labournet zu finden: http://www.labournet.de/diskussion/arbeit/aktionen/2009/bernau.pdf